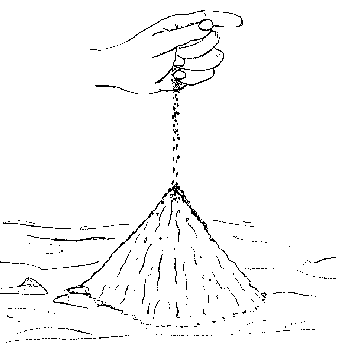
Immer geht es nur darum, die Gegenwart zu ordnen.
Was fruchtet es über ihre Erbschaft zu streiten?
Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.
Antoine de Saint- Exypéry
Die größten Dinge in der Welt werden durch andere zuwege gebracht, die wir nichts achten,
kleine Ursachen, die wir übersehen, und die sich endlich häufen.
Georg Christoph Lichtenberg
Aus heiterem Himmel fällt Regen, bricht ein Vulkan aus, löst sich eine Lawine, entsteht ein Waldbrand, grassiert eine Epidemie, erschüttert ein Erdbeben das Land.
Auf den ersten Blick scheint diese wahllos aufgezählten, aus den verschiedensten Bereichen der Umwelt stammenden Phänomene nicht mehr zu verbinden als, aus heiterem Himmel, also unerwartet und unvorhergesehen in den Alltag der ahnungslosen Menschen einzubrechen. Die Unvorhersehbarkeit derartiger Ereignisse wird traditionellerweise der menschlichen Unfähigkeit zugeschrieben, die zugrundeliegenden komplexen Systeme hinreichend genau zu erfassen. Die wissenschaftlichen Bemühungen sind daher darauf ausgerichtet, auf der Grundlage möglichst umfassender Datenmengen die für das Systemverhalten wesentlichen Elemente zu erkennen und zu isolieren, um die Variablen auf ein handhabbares Maß zu reduzieren.
Trotz großer Bemühungen hat dieses Vorgehen bei zahlreichen komplexen Systemen bislang nicht zum erwarteten Erfolg geführt. Der Vorhersagehorizont von Wetterprognosen beispielsweise nimmt sehr viel langsamer zu als der technische und rechnerische Aufwand, mit dem immer mehr Daten erfaßt und zu einer Prognose verarbeitet werden. Die Vorhersage des Wetters über Zeiträume von mehr als einigen Wochen scheint nach wie vor völlig unmöglich. Aus dem Blickwinkel der nichtlinearen Physik sind derartige Bemühungen sinnlos, weil eine der wesentlichen Voraussetzung nicht gilt: die Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Elementen. Kleinste, scheinbar unbedeutende Vorgänge beeinflussen das Systemverhalten ähnlich stark wie große und häufig auftretende Vorgänge, indem sie nach Art einer Kettenreaktion über alle Größenordnungen des Systems hinweg wirksam werden. Dabei können Ereignisse unabhängig von ihrer räumlichen und zeitlichen Entfernung zusammenwirken.
Ein solches Verhalten erinnert einerseits an kritische Phänomene (Phasenübergänge). Man denke beispielsweise an den Umschlag eines Ferromagneten vom unmagnetischen in den magnetischen Zustand, sobald die Curietemperatur unterschritten wird. Die zufällige Ausrichtung eines kleinen Bereiches wächst über alle Grenzen und bestimmt die Ausrichtung des ganzen Magneten. Andererseits ist die Variation eines Kontrollparameters überhaupt nicht nötig, um das System kritisch zu machen. Es organisiert dieses durch Rückkopplungsmechanismen von selbst.
Zur Beschreibung derartiger selbstorganisierter kritischer Phänomene
ist in den letzten Jahren eine Theorie vorgeschlagen worden, die
als Selbstorganisierte Criticalität (SOC) bezeichnet wird
[1]. Das Faszinierende an dieser Theorie ist nicht nur ihre universelle
Gültigkeit unabhängig von den konkreten Mechanismen,
die das jeweilige Systemverhalten bestimmen, sondern auch die
Einfachheit einer modellmäßigen Realisierung. Die Theorie
kann als Ergebnis einer Verbindung von Empfindlichkeit und Unempfindlichkeit
angesehen werden: Einerseits machen sich in der Nähe des
kritischen Zustandes kleinste zufällige Störungen über
alle Größenordnungen hinweg bemerkbar und bestimmen
insofern das Verhalten des Systems. Andererseits erweist sich
das System im kritischen Zustand relativ unempfindlich gegenüber
Störungen: Es findet stets von selbst in den kritischen Zustand
zurück.
Um einen solchen Vorgang zu verstehen, betrachten wir ein sehr einfaches Modell, mit dem die meisten Menschen von Kindheit an eine gewisse Intuition verbinden: den Sandhaufen. Wer hätte nicht den durch die Finger oder das Stundenglas rieselnden Sand vor Augen, der sich zu einem kegelförmigen Haufen auftürmt. Wir betrachten einen Sandhaufen mit einer bestimmten Grundfläche, auf den wir nach und nach einzelne Sandkörner fallen lassen und beobachten, was passiert: Am Anfang bleiben die Körnchen in der Nähe der Stelle liegen, an der sie auftreffen. Sobald die Steigung des allmählich wachsenden Haufens größer wird und an einzelnen Stellen einen kritischen Wert überschreitet, wird das Verhalten unvorhersagbar: Je nachdem ob durch das Hinzufügen des Sandkörnchens an einer bestimmten Stelle die Steigung den kritischen Wert überschreitet oder nicht, rutscht es ab oder bleibt liegen. Wenn das Teilchen aber abrutscht und sich zu einem der nächst tiefer liegenden Teilchen hinzugesellt, kommt es erneut zu einer solchen Entscheidung.
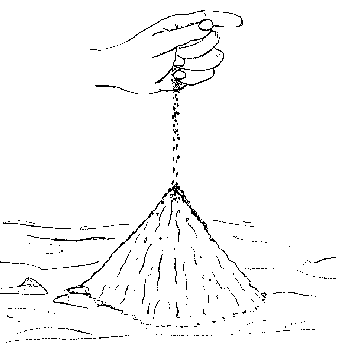
Auf diese Weise entstehen je nach der Steigung der durch das Abrutschen betroffenen Stellen mehr oder weniger große Lawinen. Schießen die abrutschenden Lawinen schließlich über die Grundfläche des Sandhaufens hinaus, so verlassen die entsprechenden Sandkörner das System. Der Sandhaufen erreicht einen (statistisch) stationären kritischen Gleichgewichtszustand, in dem sowohl seine Größe (Teilchenzahl) als auch die Steigung im zeitlichen Mittel konstant bleiben. Kritisch ist er insofern, als jetzt jedes hinzukommende Körnchen eine Lawine beliebiger Größenordnung auslösen kann, stationär insofern, als trotz der abgehenden Lawinen im zeitlichen Mittel genauso viele Teilchen auf den Haufen hinabrieseln, wie ihn verlassen. Daraus ergibt sich unmittelbar die Konsequenz, daß kleinere Lawinen häufiger auftreten als größere.
Wie kommt es zur Einregelung dieses kritischen Gleichgewichtszustandes? Befindet sich die mittlere Steigung des Haufens unterhalb der kritischen Größe, so treten vorwiegend kleine Lawinen auf, weil die Teilchen mit größerer Wahrscheinlichkeit stabile Positionen vorfinden. Der Haufen wächst dann in kleinen Schritten bis zur kritischen Steigung. Oberhalb der kritischen Steigung treffen die Teilchen mit geringerer Wahrscheinlichkeit stabile Positionen an. Sie geraten stattdessen ins Rutschen, reißen dabei eventuell benachbarte Teilchen mit sich, die ihrerseits mangels stabiler Positionen weitere Teilchen in Bewegung versetzen und so vorwiegend zu größeren Lawinen führen. Betrachtet man die mittlere Lawinengröße als Funktion der mittleren Steigung, bei der sie ausgelöst werden, so stellt man fest, daß sie mit wachsender Steigung überproportional also nichtlinear anwächst. Die Nichtlinearität erscheint auch hier ähnlich wie bei anderen dissipativen Systemen als Voraussetzung für die selbstorganisierte Einregelung und Stabilisierung des kritischen Gleichgewichtszustandes des Sandhaufens und kann durch das (nichtlineare) Gegeneinanderwirken von entgegengesetzten Tendenzen erklärt werden[ 2].
Die Abweichung vom kritischen Zustand zur einen und zur anderen
Seite kommt letztlich dadurch zustande, daß die kritische
Steigung nur im statistischen Mittel eingeregelt wird, so daß
in einzelnen Fällen hinzugefügte Teilchen auch über
die kritische Steigung hinaus liegen bleiben oder beim Abrutschen
von Lawinen einzelne Teilchen auch dann mitgerissen werden, wenn
die kritische Steigung bereits unterschritten ist.
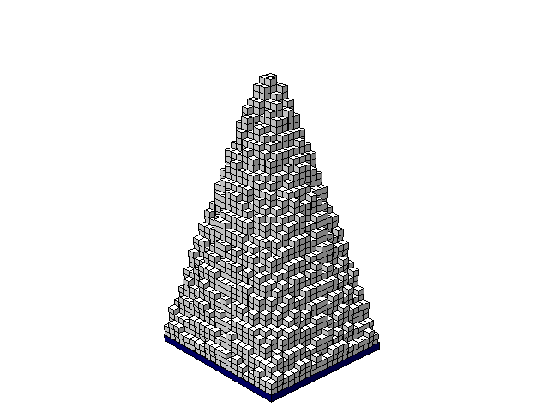
Da wir über das konkrete Verhalten des Sandes hinaus an einem allgemeinen Algorithmus für das selbstorganisierte kritische Verhalten beliebiger Systeme interessiert sind, betrachten wir einen möglichst einfachen Algorithmus, mit dem dieses Verhalten numerisch simuliert werden kann[ 1].
Wir gehen von der folgenden Situation aus: Den einzelnen Positionen eines zweidimensionalen Feldes (x, y) der Größe N x N werden "Steigungen" z(x, y) zugeordnet.
Wenn durch das Hinzufügen eines Teilchens z(x, y) größer als die kritische Steigung zmax wird, so treten Umordnungen auf, die den Haufen jeweils lokal in die stabile Situation z(x, y) < zmax(x, y) zurückführen. Das geschieht in der Weise, daß sich die Steigungsverhältnisse bei (x, y) und den vier nächsten Nachbarn (x, y1) und (x1, y) in der folgenden Weise ändern:
Grob veranschaulichen kann man sich den Algorithmus dadurch, daß man die Steigungen als Summe von Höhendifferenzen zwischen einer Position und den nächst niedrigen Nachbarpositionen vorstellt. Beim Überschreiten der kritischen Steigung kann die Umordnung als Folge des "Abrutschens" eines Teilchens angesehen werden, das ggf. weitere Teilchen zum Abrutschen veranlaßt.
Die Umordnung wird so lange vorgenommen bis die Bedingung z(x, y) < zmax(x, y) erfüllt ist. M.a.W .: Solange die kritische Steigung nicht unterschritten wird, reißen abrutschende Teilchen weitere Teilchen mit sich und so weiter. So kommt es zu mehr oder weniger großen Lawinen.
Bei der konkreten Umsetzung dieses Algorithmus geht man nun folgendermaßen vor. Allen Stellen (x, y) des betrachteten Feldes werden zufällige Steigungen z >> zmax zugeordnet. Anschließend läßt man diesen "unmöglichen" Haufen mit Hilfe des obigen Algorithmus in den stabilen kritischen Zustand übergehen, in dem für alle Felder z < zmax gilt. Das erreicht man z.B. dadurch, daß alle Positionen hinsichtlich ihrer Stabilität "abgefragt" werden und entsprechend nach dem obigen Schema verändert werden.
Das so präparierte Feld stört man schließlich
lokal, indem man jeweils an verschiedenen, zufällig ausgewählten
Stellen ein Teilchen hinzufügt und die Antwort des Systems
in Form einer mehr oder weniger großen Umordnung (Lawine)
nach dem obigen Schema abwartet.
Typische Ergebnisse eines solchen Vorgangs zeigt Bild 3. Die jeweils dunkel gefärbten Bereiche bezeichnen die Stellen des Feldes, an denen infolge einer kleinen Störung (Hinzufügung eines Teilchens an einer einzigen Stelle) Veränderungen aufgetreten sind. Sie stellen den von einer Lawine betroffenen Bereich des Feldes dar.
Auffallend ist, daß Lawinen aller Größenordnungen
entstehen. Eine lokale Störung kann also entweder auf die
Stelle beschränkt bleiben, an der sie erfolgt, oder sich
über beliebige Entfernungen im System ausbreiten. Welcher
Fall konkret eintritt, hängt davon ab, an welcher Stelle
zufällig die Störung erfolgt. Das Fehlen einer charakteristischen
Größe für die Ereignisse hat zur Folge, daß
man auch keine charakteristische Zeit für das Abklingen der
Ereignisse beobachtet.
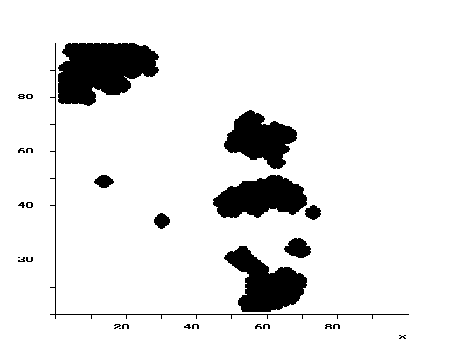
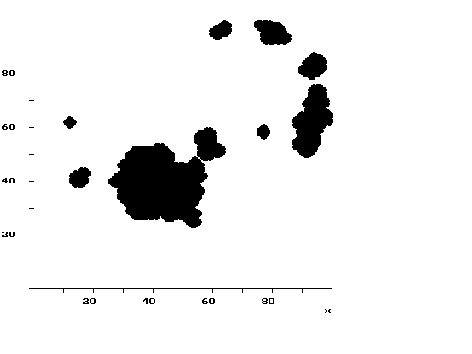
Im Sinne der eingangs gestellten Frage, ob der Häufigkeit H(f) von Lawinen der Größe f (Zahl der betroffenen Stellen) eine statistische Gesetzmäßigkeit zugrundeliegt, untersuchen wir sehr viele SOC- Lawinen. Dazu tragen wir H(f) gegen f auf. Bei doppelt- logarithmischem Maßstab erkennt man (Bild 4), daß die Verteilung H(f) über mehrere Größenordnungen hinweg durch eine Gerade mit der Steigung
m = lnH(f)/ln(f)
charakterisiert ist, so daß die Verteilung durch das folgende Potenzgesetz bestimmt wird:
H(f) ~ f-m.
Für die von uns ausgeführten Simulationen erhalten wir für
m 0,98.
Mit anderen Worten:
H(f) ~ 1/f.
Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom sogenannten 1/f- Verhalten bzw. vom 1/f - Rauschen. Damit wird ein Zusammenhang mit Vorgängen angedeutet, die schon seit langem bekannt sind, nämlich das rosa Rauschen oder Flackerrauschen, wie es z.B. in elektronischen Bauelementen auftritt. Das 1/f - Rauschen ist anders als das weiße Rauschen (bei dem kein Zusammenhang (Korrelation) zwischen gegenwärtigen und vergangenen Ereignissen besteht,) kein reines Zufallssignal, sondern hängt in einem gewissen Maß noch von vergangenen Ereignissen ab. In diesem Zusammenhang spricht man nicht nur bei m = 1 von 1/f- Verhalten, sondern auch noch bei Vorgängen, die durch 0,5 <m < 1,5 gekennzeichnet sind.
Die Abhängigkeit von der Vorgeschichte läßt sich auch beim Sandhaufen feststellen. Ob nämlich vorwiegend große oder kleine Lawinen abgehen, hängt davon ab, wie weit der aktuelle Zustand das System im Mittel vom kritischen Zustand entfernt ist, und das ist durch die Geschichte des Systems festgelegt worden. Der Exponent m kann als Maß dieser Abhängigkeit aufgefaßt werden.
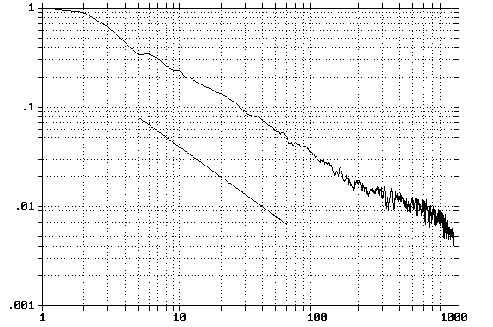
1/f- Verhalten tritt in der Natur äußerst häufig
auf. Man findet es bei der Sonnenaktivität, der Ausstrahlung
von Galaxien, dem Stromfluß durch einen Widerstand, der
Wasserströmung in einem kleinen Flußbett usw. Ja, sogar
Musik kann als typisches 1/f- Phänomen angesehen werden[
3].
Mit der Theorie der SOC lernen wir eine physikalische Beschreibung des Verhaltens komplexer Systeme kennen, die sich sehr stark vom Gewohnten unterscheiden. Hervorzuheben ist insbesondere, daß in diesem Rahmen komplexe Systeme einer physikalischen Erfassung zugänglich gemacht werden können, die bislang als unberechenbar galten. Zwar gelingt es auch mit Hilfe der SOC nicht, das Systemverhalten im einzelnen vorherzusagen. Aufgrund der potenzgesetzartigen Verteilung der Ereignisse, die in diesen Systemen stattfinden, erlangt man aber ein Verständnis dafür, daß eine detaillierte Vorhersage des Verhaltens mit der Dynamik derartiger Systeme gar nicht vereinbar ist und nicht etwa der Beschränktheit des derzeitigen Standes der Wissenschaft zuzuschreiben ist.
Die SOC eines Systems läßt sich kennzeichnen durch die Häufigkeit, mit der große und kleine Ereignisse auftreten, genauer: durch die Größenverteilung der Ereignisse. Dabei stellt man fest, daß eine solche Verteilung nicht von den mikroskopischen Wechselwirkungen zwischen den Subsystemen abhängt und daher auch wenig zum "Verständnis" des Systemverhaltens beiträgt. Daraus erklärt sich die Tatsache, daß völlig verschiedene Systeme nach demselben Schema der SOC beschrieben werden können und sich lediglich durch die spezielle Form des Potenzgesetzes unterscheiden. Bei SOC zeigenden Systemen sind dieselben Mechanismen für kleine und für große Ereignisse verantwortlich. Ob es vornehmlich zu kleineren oder größeren Ereignissen kommt, hängt davon ab, ob und in welchem Maße das System unter- oder überkritisch ist, also von der Vorgeschichte des Systems.
Die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen eines Systems bleiben
als Bestandteil der Systemdefinition unabhängig vom aktuellen
Verhalten (also z.B. davon, ob vorwiegend kleine oder große
Lawinen ausgelöst werden) stets dieselben und erlauben daher
überhaupt keine Rückschlüsse auf die Lawinentätigkeit
des Systems. Durch die vorliegende Untersuchung der Auswirkungen
von Störungen des Systems gewinnt man Aufschluß über
die Korrelationen zwischen den Teilchen des Systems. Man erfaßt
auf diese Weise das Systemverhalten aus molekularstatistischer
Sicht: Trotz der Gleichartigkeit der Wechselwirkungen, gleichgültig
ob sie beispielsweise fernab oder in der Nähe des kritischen
Zustandes stattfinden, können sich die Korrelationen drastisch
ändern. Von der Reichweite und der Stärke der Korrelationen
hängt es ab, wie ein lokales Ereignis die übrigen Teile
des Systems beeinflußt. Die Kenntnis der Korrelationen kann
daher für die Beschreibung des Systemverhaltens wichtiger
sein als alles andere.
Zahlreiche der in der Natur vorkommenden Phänomene mit 1/f- Verhalten lassen sich mit Hilfe der Theorie der SOC deuten. Nicht selten läßt sich dabei die Vorstellung der Lawinenbildung auf unseren Modellsandhaufen übertragen und ermöglicht auf diese Weise auch einen anschaulichen Zugang zu Phänomenen, die ansonsten nur Gegenstand einer komplizierten Statistik bleiben würden.
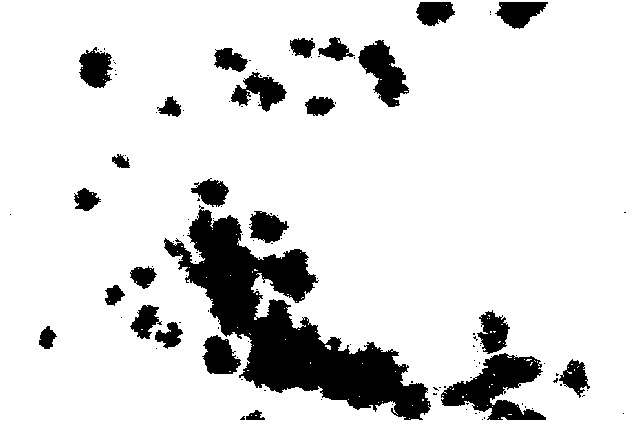

Bild 5: Gescante Fotos von verschiedenen Flechtenbewüchsen
auf einer Betonstraße.
Beispielsweise läßt sich das vermehrte Auftreten von Waldbränden mit Hilfe der SOC erklären. Länger anhaltende Trockenheit kann unter bestimmten Umständen dazu führen, daß sich Baum- oder Buschbestände von selbst in einen kritischen Zustand entwickeln, bei dem kleinste Einwirkungen, z.B. die Konzentration von Sonnenstrahlen durch weggeworfene Glasflaschen einen sich kettenreaktionsartig ausbreitenden Brand hervorrufen können. Die abbrennende Fläche wird bestimmt durch die Pflanzen, die im kritischen Zustand sind. In der Praxis sind die Verhältnisse jedoch insofern komplizierter, als unter dem Einfluß des Brandes angrenzende Waldstücke erwärmt und getrocknet und damit kritisch werden, die vorher nicht in diesem Zustand waren, so daß unter Umständen der Waldbrand nicht auf bestimmte mehr oder weniger große Stellen beschränkt bleibt, sondern den ganzen Wald "abgrast".
Auch das plötzliche Auftreten von Erdbeben kann durch die SOC modellmäßig erfaßt werden. Hier erzielt die Anwendung der SOC ihre größten Erfolge. Bereits im Jahre 1956 entdeckten B. Gutenberg und Ch. F. Richter eine empirische Beziehung zwischen der Häufigkeit großer und kleiner Erdstöße in einem bestimmten Gebiet (das Gutenberg- Richter- Gesetz). Danach verhält sich die Anzahl der Erdbeben pro Jahr, die einen bestimmten Energiebetrag E freisetzen, wie 1/Eb mit einem Exponenten b, der unabhängig vom Erdbebengebiet, in dem die Erhebungen erfolgten, einen Wert von etwa 1,5 besitzt. Man erkennt unschwer das oben erwähnte 1/f- Verhalten ([ 4]-[ 6]).
Bei der Beschreibung realer Systeme erweist sich der SOC- Algorithmus
allerdings oft als zu einfach. In solchen Fällen reicht es
häufig aus, ihn dahingehend zu erweitern, daß man die
kritische "Steigung" z zu einer Variablen macht, die
dann als Funktion des momentanen Systemzustands zu fungiert und
beispielsweise aufgrund von Rückkopplungs- Selbstverstärkungsmechanismen
direkt von der aktuellen "Lawinengröße abhängig
sein kann.
Als Experimente, die auch mit Mitteln der Schulphysik durchführbar sind, bieten sich zunächst die Untersuchung wirklicher Sandhaufen an. Dabei läßt man beispielsweise einzelne Sandkörner auf einen auf einer empfindlichen Waage befindlichen Sandhaufen rieseln und registriert die Massenveränderungen des Sandhaufens pro zugefügtem Sandkorn oder die Massen der über den Rand rutschenden Körner, die als Maß für die Größe der Lawinen angesehen werden können. Je nach der Empfindlichkeit der vorhandenen Waage bietet es sich an mehr oder weniger groben Kies, Schrauben oder andere Schüttgüter zu verwenden.
Manchmal findet man Erscheinungen in der Natur, die stark an Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. erinnern. Die Ansammlung
von Tannennadeln u.ä. auf einer Wasserpfütze, Schaum
auf einem Teich mit Zulauf, zu mehr oder weniger großen
Aggregaten, sind öfter zu findende Beispiele. Aber auch die
in Bild 5 dargestellten gescanten Fotos von Flechtenbewuchs auf
einer Betonstraße, haben ein ähnliches Aussehen wie
die Lawinen in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..
Ob es sich dabei wirklich um SOC- Phänomene handelt, müßte
empirisch ermittelt werden. Dazu bräuchte man nur die entsprechenden
Aggregate auszählen, ihre Größe bestimmen und
damit die Häufigkeitsverteilung ermitteln.